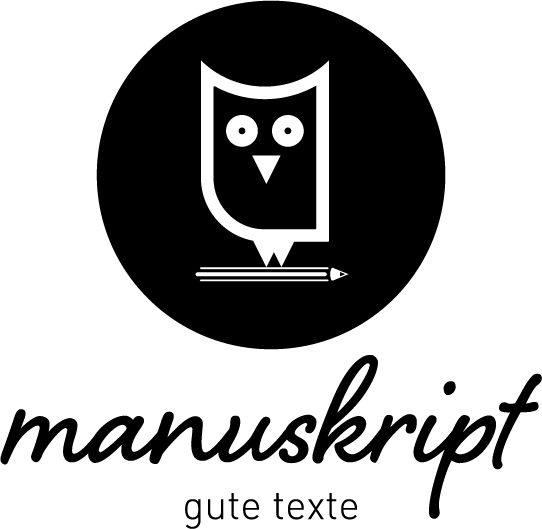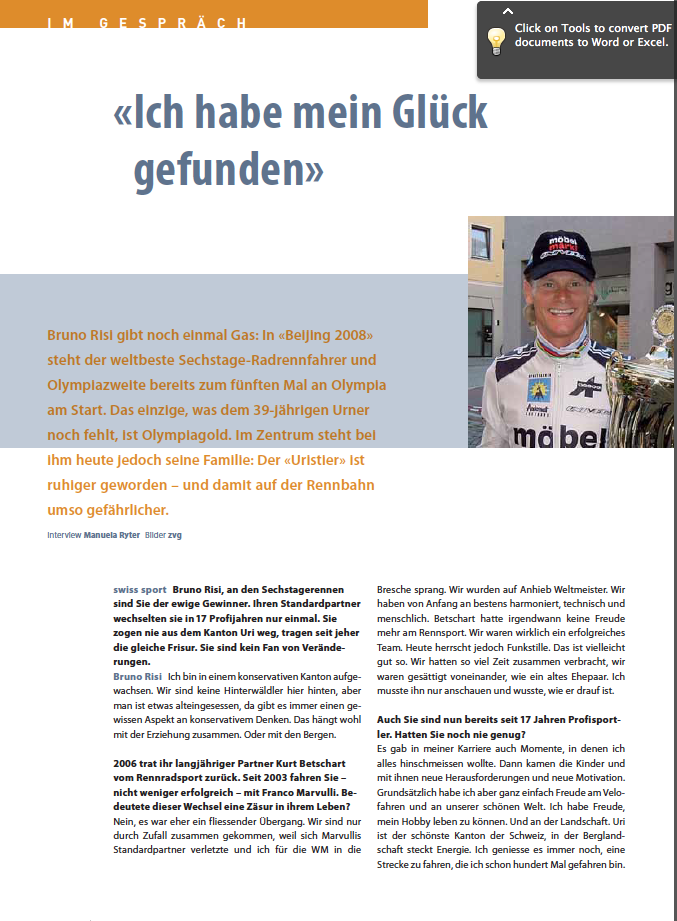Jeder Mensch hat seine innere Uhr. Stimmt diese wie bei der Nachtarbeit nicht mit der «äusseren» Uhr überein, wird er krank. Noch hat die Wissenschaft keine Lösung gefunden: In Sachen Schichtarbeit steckt die Forschung in den Kinderschuhen, wie eine Tagung zeigt.
Es ist mitten in der Nacht, doch die Lichter in der Fabrik brennen. Die riesigen Maschinen laufen Tag und Nacht, sie abzustellen wäre ökonomisch nicht vertretbar. Die Fabrikangestellten müssen auch in der Nacht an die Arbeit. Auch der Herzkranke im Spital muss während 24 Stunden betreut werden. Flugzeuge landen um Mitternacht, Züge werden nachts gewartet, Zeitungen nachts gedruckt. Über 500000 Menschen in der Schweiz arbeiten, während die anderen in ihren Betten liegen: Sie arbeiten in Schichten und lösen sich ab, damit der Betrieb während 24 Stunden läuft.
Neben sozialen hat dieser unregelmässige Rhythmus auch ökonomische und gesundheitliche Folgen: In der Nacht passieren viel mehr Arbeitsunfälle und Fehler. Viele Betroffene leiden unter Schlafstörungen und Verdauungsproblemen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie erkranken – etwa an Krebs oder Depressionen – ist um ein Vielfaches grösser als bei Angestellten mit normalen Arbeitszeiten. Der Grund dafür ist das Tageslicht, das ihnen in der Nacht fehlt und sie tagsüber nicht schlafen lässt. Doch weshalb ist Licht für die Gesundheit so wichtig? Welche Rolle spielt es am Arbeitsplatz? Die Tagung «Licht und Nachtarbeit» in Winterthur, organisiert durch das Nationale Forum Nachtarbeit, ging diesen Fragen nach.
Innere Uhr gibt Tagesablauf vor
«Alles hat seine zeitliche Ordnung», sagte Professorin Anna Wirz-Justice, die seit Jahren am Zentrum für Chronobiologie in Basel über die biologischen Rhythmen forscht: «Jedes einzelne Lebewesen hat seine innere Uhr.» Auch der Schlaf-Wach-Zyklus ist synchronisiert: Es ist die innere Uhr, die den Menschen dirigiert und bestimmt, wann Zeit zum Schlafen, Aufwachen, Essen, Verdauen oder Entleeren ist. Mit der Ausschüttung des Hormons Melatonin sorgt sie dafür, dass man abends müde wird, ins Bett geht und einschläft. Und am Morgen gibt sie dem Körper mit Cortisol das Signal, aufzuwachen und wach zu bleiben. Und dies exakt im 24-Stunden-Rhythmus.
Die Sonne richtet die innere Uhr
So perfekt die innere Uhr ist, so tückisch ist sie für die moderne Gesellschaft. Denn sie richtet sich nicht nach Arbeitszeiten oder sozialem Umfeld, sondern in erster Linie nach der Sonne: Melatonin wird mit dem Verschwinden des Tageslichts ausgeschüttet, Cortisol mit dem Hellerwerden. Das führt dazu, dass in den meisten Schlafzimmern der Wecker lange vor der inneren Uhr schrillt. Bei Menschen, die in der Nacht arbeiten, ist die Differenz riesig, was für sie verheerende Folgen hat: Wegen der verkehrten Arbeitszeiten sind sie einem dauernden Jetlag ausgesetzt – ähnlich wie nach einem Flug von Zürich nach New York: «Sie arbeiten, wenn das Hormon Melatonin den Körper auf Schlaf trimmt. Und sie gehen ins Bett, wenn der hohe Cortisolspiegel dafür sorgt, dass sie wach bleiben», sagt Wirz-Justice. Doch während sich der Körper nach einem langen Flug schon nach wenigen Tagen der neuen Aussenzeit anpasse, bleibe die Uhr des Nachtarbeiters verstellt, da kein Licht vorhanden sei, nach dem sich der Körper richten könne: «Der Zeitpunkt der Lichtexposition ist massgebend.»
Die Bedeutung des Lichts als Zeitgeber des Menschen erkläre, weshalb in der Nacht besonders viele Arbeitsunfälle und Fehler passierten. Und auch, weshalb viele Schichtarbeiter nach der Arbeit trotz hohem Schlafdruck unruhig und lediglich vier bis fünf Stunden schlafen könnten. Die Folge davon ist ein chronischer Schlafmangel, da der Körper sich weder nachts noch tagsüber regenerieren kann.
Licht gegen die Müdigkeit
Zwar kann die Sonne am Arbeitsplatz nachgeahmt werden: Intensives Licht in den Arbeitsräumen und spezielle Lichtbehandlungen während der Arbeitspausen werden bereits heute gegen die Müdigkeit der Nachtarbeiter eingesetzt, wie an der Tagung mehrere Fachleute ausführten. Auch Verdunkelungsbrillen für den «Feierabend am Morgen» gibt es, damit der Körper am Morgen auf Schlaf umstellt. Die moderne Lichtgestaltung richtet sich auch mehr und mehr nach den Erkenntnissen der Chronobiologie: Dank Lampen, die das Licht je nach Tageszeit verändern, richtet sich die innere Uhr nach dem künstlichen Licht, das die Nacht für den Körper zum Tag macht, und verschiebt sich nach und nach. Damit könnten Fehler und Unfälle reduziert werden, sagt Wirz-Justice. Das sei gut fürs Unternehmen. Für den Arbeitnehmer allerdings sei auch diese Lösung nicht befriedigend, denn «schon beim nächsten Schichtwechsel kommt er in den nächsten Jetlag».
Schichtarbeit für Nachtmenschen
Die Chronobiologie sieht die Lösung denn auch eher in individuelleren Arbeitszeitmodellen. Denn wie die Forschung der vergangenen Jahre gezeigt hat, ist es angeboren, ob ein Mensch Nachtarbeit erträgt oder nicht: Es gibt frühe und späte «Chronotypen». Auf der einen Seite die Lerchen, die Frühaufsteher, und auf der anderen die Eulen, die Nachtmenschen, die spät einschlafen und spät aufwachen, falls kein Wecker klingelt. Zwar ist die innere Uhr auch durch Alter und Geschlecht bedingt – Kinder sind eher frühe Typen, Teenager sind Eulen, alte Menschen Lerchen und Männer sind eher Eulen als Frauen. Auch ob jemand ein Langschläfer ist oder nicht, ist angeboren und kann wie die innere Uhr kaum von aussen beeinflusst werden. «Chronotyp und Schichtarbeit müssen deshalb dringend synchronisiert werden», fordert Wirz-Justice. Frühe Chronotypen könnten unmöglich Nachtschicht machen. Und späte sollten nicht für die Frühschicht eingeteilt werden, da sie sonst nicht zu genügend Schlaf kommen.
Doch wie findet ein Arbeitgeber heraus, welche Schicht zu welchem Mitarbeiter passt? Die Wissenschaft arbeite an Modellen, doch noch habe man zu wenige Ergebnisse, sagte Till Roenneberg, Professor der Chronobiologie aus München, an der Tagung. Bisherige Studien seien unbrauchbar, da sie die innere Uhr als Faktor nicht beachteten. «Es braucht deshalb noch viel Feldarbeit.» Klar sei jedoch: Die Spannweite der angeborenen Tagesrhythmen sei riesig, die Individualität gross. Grundsätzlich gebe es jedoch mehr Nachtmenschen als Frühaufsteher. Doch nicht nur die Gene, auch das Licht bestimmt, wann wir aufstehen: Im Osten der gleichen Zeitzone, wo die Sonne früher aufgeht, stehen Menschen früher auf als im Westen. Und in der Stadt stehen sie später auf als auf dem Land, wo sich die Menschen häufiger draussen aufhalten und der Sonnenaufgang eher sichtbar ist.
Nachtarbeit schadet Gesundheit
Auch wenn die Wissenschaft erst wenig über die Folgen von Nacht- und Schichtarbeit auf den Menschen aussagen kann – eines wisse man ohne jeden Zweifel, sagt Roenneberg: «Schichtarbeit ist gesundheitsschädigend.» Je stärker die verschiedenen Rhythmen auseinanderklafften, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Roenneberg legte den anwesenden Arbeitgebern deshalb nahe, sich für mehr Grundlagenforschung und bessere Arbeitsbedingungen zu engagieren. Denn sonst könne es teuer werden: «Rauchen ist freiwillig – trotzdem gingen viele Raucher mit Erfolg gegen Tabakfirmen vor Gericht. Was passiert, wenn plötzlich eine Welle von Schichtarbeitern vor Gericht geht?» Denn: Schichtarbeiter seien nicht selber schuld, wenn sie erkranken.
Interview:
«Ich plädiere für spätere Arbeitszeiten»
Nicht nur Schichtarbeiter sind vom «sozialen Jetlag» betroffen – auch viele Nachteulen können in unserer Gesellschaft nicht nach ihrer inneren Uhr leben. Anna Wirz-Justice fordert deshalb spätere Schul- und individuell flexible Arbeitszeiten.
«Bund»: Unregelmässige Arbeitszeiten betreffen nicht nur Schichtarbeiter: Manager jetten um die Welt, Studenten lernen in der Nacht, in vielen Firmen sind Überstunden an der Tagesordnung. Müssen wir mit weniger Schlaf auskommen?
Anna Wirz-Justice: Ja. Arbeit, Freizeit, Sport, Familie – es wird immer mehr, was in 24 Stunden Platz haben muss, gespart wird nur beim Schlafen. Wir leben in einer 24-Stunden-Dienstleistungsgesellschaft, dies lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Schichtarbeit und Überstunden sind der Preis, den wir dafür bezahlen. Es trifft aber nicht alle gleich: Frühaufstehern geht es in unserer Gesellschaft besser als Eulen, die spät ins Bett gehen und trotzdem früh raus müssen. Letztere leben wie Schichtarbeiter in einem ständigen Jetlag. Die Folge ist ein konstanter Schlafmangel – um diesen Schlaf nachzuholen, braucht es rund drei Wochen Ferien.
Reden Sie aus Erfahrung?
Ja, ich bin eine extreme Eule. Ich habe lange Zeit gelitten, als ich jeden Morgen früh im Büro stehen musste. Heute bin ich freie Mitarbeiterin und kann wählen, wann ich aufstehen will. Normalerweise zwischen neun und zehn Uhr, ins Bett gehe ich zwischen ein und zwei Uhr, so bin ich ausgeschlafen.
Weshalb ist die innere Uhr so wichtig?
Weil unsere gesamte Physiologie und unser Verhalten darauf abgestimmt ist. Sie ist eine fantastische Zeitorganisation und sagt voraus, was wir als nächstes tun. Sie ist auch eine Art Energieeffizienz: Sie sorgt dafür, dass wir zur richtigen Zeit die richtige Funktion ausüben.
Es gibt unter uns mehr Eulen als Lerchen – die Schweizer gelten jedoch als Frühaufsteher.
Ja, wir leben in einer Lerchengesellschaft, obwohl viel mehr Menschen Eulen sind, als man denkt. Es gilt auch nach wie vor als faul, wer morgens länger schläft und später ins Büro kommt. Dabei sieht niemand, was diese Leute abends leisten. Für Lerchen dagegen ist Nachtarbeit schwierig.
Gibt es keine Möglichkeit, sich an die Arbeitszeiten anzupassen?
Man kann sich anpassen, aber am Wochenende müssen die Schlafdefizite kompensiert werden. Dies kann also nur eine Übergangslösung sein, denn die innere Uhr passt sich nicht an: Sie ist angeboren und wird zusätzlich von Geschlecht und Alter beeinflusst, sie lässt sich also nicht einfach so verstellen. Einzig durch Licht lässt sich die innere Uhr verschieben.
Müssten also die Arbeitszeiten an die Menschen angepasst werden?
Ja. Es braucht dringend individuellere Arbeitszeiten, die es ermöglichen, den Tagesablauf des Einzelnen besser mit seiner inneren Uhr abzustimmen. Gerade für Jugendliche, die typischen Eulen in unserer Gesellschaft, müssten Arbeits- und Schulzeiten angepasst werden. Wahrscheinlich könnten viele Jugendprobleme gelöst werden, wenn die jugendlichen jede Nacht eine Stunde länger schlafen könnten. Beispielsweise beim Rauchen wurde ein Zusammenhang festgestellt: Je höher der soziale Jetlag, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand raucht. Schlafmangel ist also ein Risikofaktor und diesem sind fast alle Jugendlichen ausgesetzt. Dass sie früher ins Bett gehen, kann man hingegen nicht von ihnen erwarten: Ihre innere Uhr lässt sie nicht einschlafen. Wenn sie am Wochenende bis nachmittags im Bett liegen, hat dies also nichts mit Faulheit zu tun. Sie müssen den verpassten Schlaf nachholen.
Welche Folgen kann Schlafmangel noch haben?
Konzentration, Motivation und Leistungsfähigkeit könnten mit mehr Schlaf gefördert werden. Denn wer nach dem eigenen Rhythmus schläft, hat einen besseren Schlaf. Dies ist auch für den Lernprozess wichtig, denn Schlaf dient der Gedächtnisverarbeitung: Wer zu wenig oder schlecht schläft, kann weniger aufnehmen. Ein Grund mehr für die Einführung späterer Schul- und Arbeitszeiten.
Sie sind also generell für spätere Arbeitszeiten?
Eine Spätschicht für alle wäre sicher besser als eine Frühschicht – jedenfalls aus gesundheitlicher Sicht. Sozial wäre sie jedoch nicht verträglich. Das ist unser Problem: Was gut ist für die Gesundheit, ist nicht unbedingt gut fürs soziale Umfeld. Ich plädiere trotzdem für spätere Arbeitszeiten – wir sind keine Bauern mehr, es gibt keinen Grund, den Tag so früh zu beginnen.
Wird dem Schlaf in unserer Gesellschaft zu wenig Bedeutung beigemessen?
Ja, Schlaf ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Die Bedeutung des Schlafs – und damit der inneren Uhr – kann jedoch gar nicht hoch genug eingeschätzt werden: Es würde der Gesellschaft viel mehr bringen, wenn jeder nach seinem eigenen Rhythmus leben würde, als wenn jeder zur gleichen Zeit am Arbeitsplatz ist. Denn chronischer Schlafmangel hat auch wirtschaftliche Folgen: Es passieren mehr Fehler und Unfälle und die Gesundheitskosten steigen. Individuelle Schichten würden auch verhindern, dass Leute wegen Geld oder eines guten Jobs gegen ihre Uhr arbeiten. Noch kann die Wissenschaft keine Lösungen bieten. Je mehr wir wissen, wie wichtig Schlaf und die innere Uhr sind, müssen wir aber bereit sein, Lösungen zu finden.
ZUR PERSON
Anna Wirz-Justice forscht am Zentrum für Chronobiologie der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel über die biologischen Rhythmen. Sie beschäftigt sich mit Licht und Schichtarbeit und der Schlaf-Wach-Regulation des Menschen.
Text und Interview: Manuela Ryter
Diese zwei Texte erschienen am 18. Juni 2008 im "Bund".